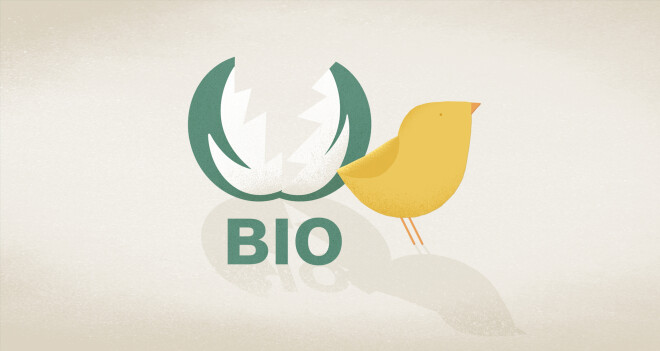Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der Misstrauen allgegenwärtig wäre. Nicht einmal die ehrenwerte Gesellschaft der Mafia könnte so existieren. Selbst die korrupteste Gesellschaft setzt Vertrauen voraus: der Korrumpierer muss sich schliesslich auf den Bestochenen verlassen können. Damit Misstrauen nicht zerstörerisch wird, muss es begrenzt und vor allem begründet sein.
Wer nicht naiv vertrauensselig sein will, muss immer wieder entscheiden, wann ein Wechsel vom grundsätzlichen Vertrauensmodus in ein spezifisches Misstrauen angeraten ist. Soziale und staatliche Institutionen entlasten uns von einem grossen Teil der Anstrengung, die mit diesen Entscheidungen verbunden ist. Zu diesen Institutionen gehören inzwischen auch Qualitätslabels und Zertifizierungen. Wer nicht die Arbeit auf sich nehmen möchte, seine Eier ausschliesslich bei der Bäuerin seines Vertrauens zu kaufen (von Hühnern, die er selbst schon auf dem Hof hat picken sehen und deren Gelege er besichtigt hat), kauft beim Grossverteiler Bio-Eier.
Das Etikett «Bio» hat eine Entlastungsfunktion. Und zwar nicht, wie immer wieder behauptet wird, eine moralische, sondern eine kognitive und eine praktische Entlastungsfunktion. Ich möchte zwar, dass Hühner unter hühnergerechten Verhältnissen gehalten werden; aber ich muss mich nicht auch noch damit beschäftigen, was genau «hühnergerechte Haltungsbedingungen» sind und ob diese in konkreten Fällen eingehalten werden. Ich entscheide mich selber für Hühnerfreundlichkeit, delegiere aber die exakte Definition und die Überwachung von deren Einhaltung an die Instanz des Labels.
In der Soziologie versteht man unter «labeling approach» einen grundsätzlich antiessenzialistischen, konstruktivistischen Ansatz zur Erklärung von abweichendem Verhalten. Kriminalität existiert nicht deshalb, weil ein Krimineller kriminelle Eigenschaften besitzt, sondern weil das, was er tut, als kriminell etikettiert wird. Nicht der Gegenstand geht dem Etikett voraus, sondern das Etikett dem Gegenstand. Bei den Bio-Eiern sollte es natürlich eigentlich anders sein: «Bio» soll eine stabile Eigenschaft der Eier selbst sein und nicht etwas, das erst durch die Etikettierung selbst entsteht. Alles andere wäre in unseren Augen Etikettenschwindel. (Solchen Etikettenschwindel zu entlarven, gehört mittlerweile zum Standard-Repertoire aller Konsumenten-Magazine, der zuverlässigen Institutionen zur Etablierung misstrauensbildender Massnahmen.)
Ist das Etikett also nichts als eine reine Äusserlichkeit, welche eine innere Wahrheit attestiert? Keineswegs. Jedes Etikett schafft eine ontologische Differenz: zwischen sich – und allem anderen. In diesem Fall zwischen bio und nicht bio. Es stärkt einerseits unser Vertrauen in bio und unterstützt Misstrauen gegenüber nicht bio. Skandale – beispielsweise über eine Pestizidbelastung bei Bio-Eiern – lassen ihrerseits nicht nur Zweifel am Label «bio» wachsen, sondern erzeugen wahrscheinlich den Wunsch nach neuen, strenger gefassten Labels. Sie regen neue Gedanken darüber an, was für Kriterien wir eigentlich für die Vergabe eines Labels zugrunde gelegt haben möchten.
Labels bilden Schnittstellen zwischen (ökologischer) Politik und individuellem Konsum. Sie politisieren den Konsum und machen Politik im wörtlichen Sinne konsumierbar. Im Idealfall bieten sie einen Ausweg aus dem Jeder-muss-bei-sich-selber-anfangen-Moralismus; im weniger idealen Fall fungieren sie einerseits als Politikersatz und andererseits als Marker der «feinen Unterschiede» im kulturellen Klassenkampf der Bios gegen die Nicht-Bios.