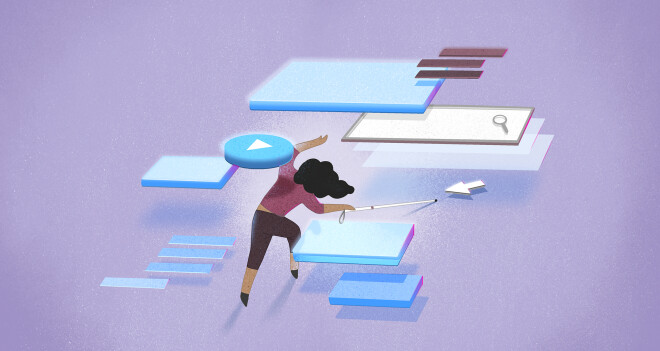Wie bezahlt eine blinde Person eine Rechnung, die per Post kommt? Nutzt sie eine E-Banking-Plattform? Oder zahlt sie gar mit dem Smartphone? Und wie sieht es mit dem kontaktlosen Zahlen an der Kasse aus? Eine Chance? Oder bloss eine weitere Hürde, die es zu meistern gilt? Digitale Dienstleistungen haben im Zuge der Pandemie gewaltig an Schub zugelegt – auch im Finanzbereich. So stieg zum Beispiel die Anzahl Transaktionen über die Bezahl-App Twint von 39 Millionen im Jahr 2019 auf 386 Millionen im Jahr 2022 an – mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung verfügt bereits über ein Konto. Auch die Aufnahme von Krediten, die Verwaltung von Wertschriften und die Altersvorsorge hat sich in den digitalen Bereich verlagert, wie eine Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte zeigt.
Menschen mit Behinderungen können von dieser Entwicklung profitieren. Denn digitale Angebote könnten so gestaltet werden, dass sie für Menschen mit Seheinschränkungen, gehörlose Personen und jene mit motorischen oder kognitiven Beeinträchtigungen gut nutzbar sind. Aber geschieht das auch?
Diese Frage stellte sich auch Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern. Gemeinsam mit einem Team von Forschenden hat der Professor für Banking die Barrierefreiheit digitaler Dienstleistungen von Schweizer Banken unter die Lupe genommen. Er wollte wissen: Können Blinde deren Websites überhaupt sinnvoll nutzen? Denn seit Jahren beobachtet er, dass Banken von ihren Kundinnen und Kunden verlangen, Geschäfte eigenständig über digitale Plattformen zu erledigen. «Wer aber eine digitale Lösung anbieten will, muss auch für jene einen Zugang schaffen, die gewisse Einschränkungen haben, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden», sagt Dietrich.
In der Schweiz gibt es rund 400 000 Menschen mit einer Sehbehinderung – manche haben Mühe, Farben und Kontraste zu unterscheiden, andere ein eingeschränktes Sehfeld, einige sind komplett blind. «Es betrifft also einen grossen Teil der Bevölkerung», sagt Dietrich. Nebst der ökonomischen Perspektive – für Banken lohne es sich ja, ein Angebot für diese Menschen bereitzuhalten – müsse auch beachtet werden, «dass niemand von der Teilhabe ausgeschlossen wird. Wenn mehr und mehr Dienstleistungen in den digitalen Raum verschoben werden, haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung, an alle Menschen zu denken und diese mitzunehmen.»
Sprich mit mir
Einer von jenen, die gern mitgenommen würden, ist Mo Sherif. Der 31-Jährige ist «mehr oder weniger von Geburt an blind». Nach einer Lehre als Applikationsentwickler arbeitet er seit einigen Jahren bei der Stiftung «Zugang für alle» als Accessibility-Berater. Dort prüft er, ob digitale Angebote für Menschen wie ihn überhaupt nutzbar sind und wo es noch Luft nach oben gibt. «Als blinder Informatiker habe ich natürlich ein recht gutes Gefühl dafür, wie digitale Angebote funktionieren müssten, wenn sie auch für Blinde anwendbar sein sollen», sagt er.
Während Sehende mit den Augen und der Maus durch eine farbenfrohe Website navigieren, ist der Screenreader für Sherif das A und O. Diese Software liest Informationen aus einer Website aus, versteht die Struktur und kann Texte oder Beschreibungen vorlesen – oft in einem rasenden Tempo, dem nur Geübte folgen können. Damit testet Sherif auch, ob eine Seite für ihn navigierbar ist, er ans Ziel gelangen kann oder Hürden in den Weg gelegt bekommt.
«Wir richten uns dabei nach den WCAG-Kriterien», erklärt Sherif. Die sogenannten Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) haben das Ziel, Internetangebote möglichst barrierefrei zu gestalten, damit auch Menschen mit Einschränkungen sie nutzen können. Darin sind Regeln festgehalten wie: «Verlass dich nicht allein auf Farben», «Sorge für klare Navigation» oder «Liefere äquivalente Alternativen für auditive und visuelle Inhalte». Seit ihrer ersten Veröffentlichung wurden die WCAG konstant weiterentwickelt und enthalten aktuell mehr als 60 messbare Kriterien. In der Realität gibt es aber kaum eine Seite, die alle erfüllt. «Die Kriterien geben uns trotzdem einen guten Anhaltspunkt, wie barrierefrei ein digitales Produkt ist», sagt Sherif. «Je mehr, desto besser.»